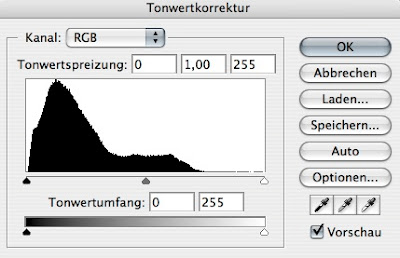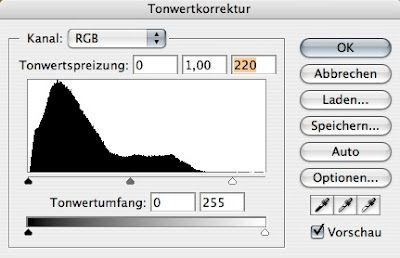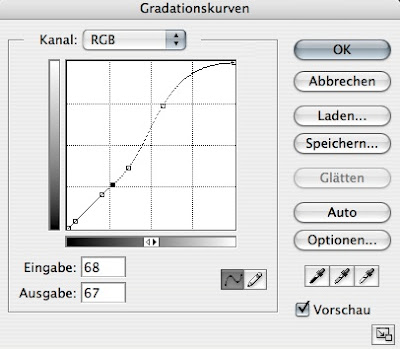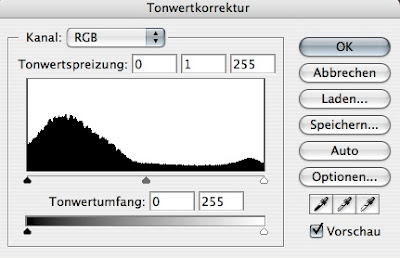Wer mit dem Händen arbeitet ist scharf auf gutes Werkzeug, wer fotografiert ist geil auf richtig scharfe Bilder.
Denn, scharfe Linse x präziser Autofokus : Süperkamera = scharfes Foto = geiles Foto.
So ist das!
Zum Thema "Schärfe" habe ich schon vor einiger Zeit ein paar Aufsätzchen (hier, hier, hier und hier) geschrieben.
Die könnte man heute zwar etwas knackiger zusammenfassen, aber die Fakten sind immer noch die gleichen.
Nun gibt es schon einige Zeit Kameras, die die Möglichkeit bieten, die Autofokusfunktion in Heimarbeit selbst zu justieren.
Ha! Endlich wirklich süperscharfe Fotos!
Und ein findiger Amerikaner - wer auch sonst - liefert dazu gegen gute Taler auch ein ganz pfiffiges Werkzeug: LensAlign.
Allerdings, der Gebrauch diesen Hilfsmittels gegen nachlassende Schärfe in der Mensch-Kamera-Beziehung, führt schnell zu einer gewissen Ernüchterung.
Man stellt fest: Schärfe ist nicht absolut, Schärfe ist sehr relativ.
Und Canon schreibt zu diesem Thema:
"Normally, adjusting the focus this way is not required. Set up AF Microadjustment only if necessary. One special scenario where this function may be useful is when there is always a specific distance, more or less, between the position of a subject (an athlete’s chest, for example) for capture with AF points and the position of desired focus (the athlete’s face, for example)."
Nun denn …
Wer eine Kamera mit LiveView-Funktion besitzt, hat alles, was es braucht um von statischen Motiven scharfe Bilder zu erzeugen.
Das Monitorbild wird direkt vom Sensor abgegriffen. Ist es scharf, muss auch der Sensor exakt im Fokus sein.
Wenn das Ergebnis trotzdem nicht befriedigt, liegt es mit Sicherheit nicht an schlechter Justage von Suchermattscheiben, Fokushilfsspiegeln und Sensoren, sondern an einer kontrastarmen Optik, die, womöglich kombiniert mit geringer Detailauflösung alle Struktur, woran sich unser Auge festhalten möchte, weich und verschwurbelt wiedergibt.
Und schon sind wir mitten drin in der Problematik des Linsentestens.
Wir montieren also unsere Kamera aufs Stativ, Einstellung JPG Fine, 100 ISO, Monochrom, Kontrast und Schärfe am Anschlag, Spiegelvorauslösung.
Die Kamera wird (mit dem künstlichen Horizont) gerade ausgerichtet, z. B. auf das schöne BIOS-Pixel-Test-Plakat.
Blende wird geöffnet, Belichtungszeit wird eingestellt, Optik auf kürzeste Entfernung eingestellt, danach fokussiert und ausgelöst.
Halt, halt, Abstand zum Plakat 25x die Brennweite (wie z. B. Canon misst) oder gar 50x wie andere vorschlagen?
Oder sollen wir das Portraitobjektiv so wie wir es häufig einsetzen mit 1,5 bis 2m Abstand vom Objekt testen? Aber was ist dann mit 5 m oder gar Unendlich?
Und wie halte ich es bei einem Zoom? Was tun wenn sich Schärfe bei kurzer und langer Brennweite unterscheiden?
Wir sehen, es tauche Fragen auf, für die wir keine befriedigenden Lösung finden.
Es gibt Optiken (wie z. B. EF 70-200/f2.8 L, EF 28-70/f2.8 L, EF 24-105/f4 L IS, EF 16-35/f2.8 L, Festbrennweiten wie das EF 100/f2, aber auch das EF 28-105/f 3.5-4.5, natürlich auch entsprechende Optiken anderer Hersteller), die zeigen bereits bei offener Blende so hervorragende Schärfe/Auflösung, dass man durch verstellen des Fokuspunktes in der Kamerasoftware nach zwei, drei Versuchen schon sagen kann, ob alles OK ist, oder ob tatsächlich ein auffälliger back- oder frontfocus vorliegt.
Schwer, fast unmöglich wird es mit Objektiven, die bei offener Blende so weich abbilden (wie z. B. das EF 28/f1.8), dass keine ausreichende Kantenschärfe zur Beurteilung vorhanden ist.
Durch Abblenden wird das zwar behoben, dafür wird aber die Tiefenschärfe so groß, dass ebenfalls kein eindeutiger Schärfepunkt mehr erkennbar ist.
Problematisch sind auch lichtschwächere Linsen mit extrem kurzer Brennweite (EF-S 10-22/f3.5-4.5), die von Natur aus schon bei offener Blende eine große Tiefenschärfe haben.
Meine Schlussfolgerung:
die meisten Kamera/Optikkombinationen entsprechen mit Sicherheit dem Industrie-Standard für "Schärfe":
"… ist die Grundlage der Schärfebeurteilung ein Print von 6x9 inch resp. 15x22 cm bei einem Betrachtungsabstand von 25 cm. Dies entspricht am Bildschirm ungefähr einer 25%-Darstellung eines Fotos einer Vollformatkamera wie z.B. der Canon 5D. Bei kleineren Senoren wäre dann eine entsprechend größere Darstellung nötig, z.B. 50%."
Sind Fotos nicht so scharf wie wir sie uns wünschen, so können die Gründe dafür vielfältig sein - die Umstände spielen ein Rolle, auch subjektive Faktoren (siehe die oben genannte Artikelserie) - selten aber tatsächlich falsch justierte AF-Funktionen.
Vergessen wir doch einfach die "technische Schärfe" und nehmen wir die "inhaltliche Schärfe" in unseren Fokus!
The proof of the pudding is - in diesem Fall - in the printing!
Wer tiefer in das Thema eintauchen will, sollte die oben genannten Artikel lesen.